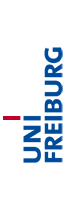Petrophysik
Permeabilitäten, Aquifere, Kluftmuster...
Die petrophysikalischen Eigenschaften bilden weitere Voraussetzungen für geothermische Energiegewinnung
Neben den  Temperaturen ist eine erfolgreiche Nutzung geothermischer Energie von den physikalischen Eigenschaften der heißen Gesteine abhängig. Dies gilt ganz besonders für die
Temperaturen ist eine erfolgreiche Nutzung geothermischer Energie von den physikalischen Eigenschaften der heißen Gesteine abhängig. Dies gilt ganz besonders für die  hydrogeothermale Nutzung, die auf natürliche heiße Grundwasserleiter angewiesen ist.
hydrogeothermale Nutzung, die auf natürliche heiße Grundwasserleiter angewiesen ist.
Porosität und Permeabilität
Grundwasserleiter oder Aquifere sind an zwei physikalisch messbare Gesteinseigenschaften geknüpft: Porosität und Permeabilität. Porosität bezeichnet den Anteil an Hohlräumen in einem betimmten Gesteinsvolumen, die unter natürlichen Bedingungen mit Flüssigkeiten (Fluiden) gefüllt sind. Als Fluide kommen Wasser, aber z.B. auch Erdöl oder Erdgas in Frage. Bleiben wir beim Wasser: In einem Kubikmeter Sandstein mit 20% Porosität befinden sich 200 Liter Wasser mit der Temperatur des umgebenden Gesteins.
Permeabilität bezeichnet dagegen die Durchlässigkeit des Gesteins für Fluide: Damit sich Fluide durchs Gestein bewegen können, müssen die Hohlräume miteinander in Verbindung stehen. Nur so kann Wasser zu einer Förderbohrung nachfließen und dauerhaft gefördert werden. Je größer die Permeabilität, desto ergiebiger ist ein Brunnen, dh. desto mehr Wasser kann pro Sekunde dem Untergrund entnommern werden.  Hydrogeothermie basiert auf diesem Brunnenprinzip.
Hydrogeothermie basiert auf diesem Brunnenprinzip.
Poren-, Kluft- und Karstgrundwasserleiter
Die für Porosität und Permeabilität verantwortlichen Hohlräume können, je nach Gesteinstyp, unterschiedliche Formen und Verteilungsmuster aufweisen. Geowissenschaftler unterscheiden deshalb drei Grundtypen von Aquiferen - an drei Beispielen aus dem "Urlaubsalltag" lässt sich das Prinzip leicht erklären:
| Porenwasserleiter - Das Wasser befindet sich zwischen den Körnern von Sedimentgesteinen, z.B. Sandsteinen. |  |
Wenn Sie am Sandstrand dicht ans Meer treten, stehen Sie auf dem perfekten Porenwasserleiter: zwischen den Sandkörnern des lockeren (hochporösen) Sandes befindet sich Wasser. Während Sie langsam einsinken, quillt Wasser aus dem Sand: das "Lockergestein" Strandsand ist also auch hochpermeabel. - In den für die Tiefe Geothermie interessanten Niveaus haben sich Sande längst zu Sandsteinen verfestigt, ein Teil der Poren ist mit "Zement" aus Mineralausscheidungen gefüllt, der das Gestein zusammenhält. Mit zunehmender Tiefe, Verfestigung und Zementation nehmen Permeabilität und Porosität von Sedimentgesteinen im Allgemeinen ab.
| Kluftwasserleiter - Risse und Spalten im Gestein sind wassergefüllt. |  |
Wenn Sie in einem Steinbruch oder an einer felsigen Straßenböschung stehen, werden Sie eine Vielzahl von Rissen und schmalen Spalten bemerken, die das Gestein durchziehen. Diese "Klüfte" sind tektonischen Urspungs, dh. durch großräumige Bewegungen in der Erdkruste aufgerissen. Häufig wachsen Pflanzen aus den Klüften - hier gibt es Wasser! Die sogenannten Kluftwasserleiter sind vor allem in tieferen Niveaus bedeutend. Auch wenn das Gestein nur im Abstand von einigen Metern Klüfte führt (geringe Porosität), können diese sehr effektive, weil hochpermeable Aquifere bilden.
| Karstwasserleiter - Große höhlenförmige Hohlräume können sich durch chemische Lösung bestimmter Gesteinstypen bilden. |  |
Karstwasserleiter lernen Sie bei der Höhlenführung kennen: ganze Bäche und Flüsse können sich hier mühelos durch den Untergrund bewegen. Spezielle Gesteine (Karbonatgesteine wie Kalk und Dolomit, aber auch Gips u.a.) werden beim Prozess der "Korrosion" durch kohlensäurehaltige Wässer chemisch gelöst, das Gestein "verkarstet". Werden verkarstete Gesteine durch andere geologische Prozesse in die Tiefe versenkt, füllen sich die Hohlräume komplett mit Wasser, und Aquifere mit höchster Permeabilität entstehen.
Verfügbarkeit tiefer Grundwasserleiter in Deutschland
 | |
| Die Bundesrepublik, gegliedert nach dem Vorkommen hydrogeothermaler Energieressourcen. Besondes Erfolg versprechend sind geologisch "junge" Sedimentbecken, wie das Molassebecken, der Oberrheingraben oder das Norddeutsche Becken. (verändert nach: Kayser & Kaltschmitt 1998) |
Quellen:
Kayser M. & Kaltschmitt M. (1998): Potentiale hydrothermaler Erdwärme in Deutschland. - In: Ehrlich H., Erbas K. & Huenges, E. (Hrsg.): Angebotspotential der Erdwärme sowie rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Nutzung hydrothermaler Nutzungsanlagen - GeoForschungsZentrum Potsdam, Scientific Technical Report STR98/09.