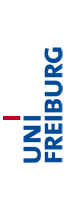Untergrund
Heiß allein ist (noch) nicht genug
Die natürlichen Voraussetzungen tiefer geothermischer Energiegewinnung
"Geothermische Gradienten, Permeabilitäten, Aquifere, Spannungsfelder" - viel mehr Fachchinesisch ist gar nicht nötig, um die wesentlichsten Grundlagen der Geothermie zu erklären. Im einzelnen ist das Zusammenspiel dieser - und vieler weiterer - Faktoren äußerst komplex und erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geologen, Mineralogen und Ingenieuren.
 | Untergrundtemperaturen in 3000m Tiefe (Quelle: Schellschmidt 2003). |
Temperaturen im Untergrund
Um geothermische Energie wirtschaftlich nutzen zu können, sind hohe Untergrundtemperaturen generell von Vorteil: je schneller die Temperatur mit der Tiefe zunimmt, desto weniger tief muss man bohren, um eine bestimmte Temperatur zu erreichen. Hinzu kommt, dass Bohrkosten mit der gewünschten Tiefe überproportional stark ansteigen. Wo sind also die Gebiete, die optimalen Erfolg versprechen?
Ein Blick auf  Temperaturkarten für verschiedene Tiefenniveaus zeigt uns, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist: Je nachdem, welche Temperaturen für eine bestimmte technische Nutzungsform erforderlich sind, eignen sich eventuell unterschiedliche Standorte: an einem Standort können z.B. 50° heiße Wässer mit minimaler Bohrtiefe erreicht und damit wirtschaftlich optimal genutzt werden, an einem anderen dagegen solche mit von Temperaturen von 150°. Den Zusammenhang zwischen Tiefen- und Temperaturzunahme bezeichnet der "geothermische Gradient" - und der ist häufig eben nichtlinear, das heißt, die Temperaturen steigen in unterschiedlichen Tiefenniveaus mal stärker und mal weniger stark an.
Temperaturkarten für verschiedene Tiefenniveaus zeigt uns, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist: Je nachdem, welche Temperaturen für eine bestimmte technische Nutzungsform erforderlich sind, eignen sich eventuell unterschiedliche Standorte: an einem Standort können z.B. 50° heiße Wässer mit minimaler Bohrtiefe erreicht und damit wirtschaftlich optimal genutzt werden, an einem anderen dagegen solche mit von Temperaturen von 150°. Den Zusammenhang zwischen Tiefen- und Temperaturzunahme bezeichnet der "geothermische Gradient" - und der ist häufig eben nichtlinear, das heißt, die Temperaturen steigen in unterschiedlichen Tiefenniveaus mal stärker und mal weniger stark an.
 | |
| Die Bundesrepublik, gegliedert nach dem Vorkommen hydrogeothermaler Energieressourcen. Besondes Erfolg versprechend sind geologisch "junge" Sedimentbecken, wie das Molassebecken, der Oberrheingraben oder das Norddeutsche Becken. (verändert nach: Kayser & Kaltschmitt 1998) |
Wasser bringt die Wärme ans Tageslicht
Das heute bedeutendste Verfahren geothermischer Energiegewinnung ist die Hydrogeothermie. Wie dies im Einzelnen funktioniert ist bei den  technischen Nutzungsmöglichkeiten beschrieben. Hier nur soviel: zur hydrogeothermalen Energiegewinnung muss ein ergiebiger heißer Grundwasserleiter ("Aquifer") erbohrt werden. Wie bei einem Brunnen wird der Bohrung dann Wasser entnommen, in diesem Fall allerdings heißes "Thermalwasser".
technischen Nutzungsmöglichkeiten beschrieben. Hier nur soviel: zur hydrogeothermalen Energiegewinnung muss ein ergiebiger heißer Grundwasserleiter ("Aquifer") erbohrt werden. Wie bei einem Brunnen wird der Bohrung dann Wasser entnommen, in diesem Fall allerdings heißes "Thermalwasser".
Wo findet man nun "ergiebige Aquifere"? Prinzipiell in Gesteinen, die ausreichende wassergefüllte Hohlräume besitzen ("Porosität"). Damit sich das Wasser durch die Hohlräume bewegen kann, müssen diese zudem miteinander verbunden sein ("Permeabilität"). Wie solche Aquifere beschaffen sein können und welche Arten von Gesteinen potenzielle Aquifere sind, finden sie im Artikel  Permeabilität.
Permeabilität.
| So könnte ein Hot Dry Rock-Kraftwerk aussehen. |  |
Bei Hot Dry Rock-Prinzip ist vieles anders
Etwas andere Faktoren sind zur Anwendung des Hot Dry Rock-Prinzips von Bedeutung. Hier werden die Permeabilitäten in Form von künstlichen Rissen im Getein durch technische Verfahren erzeugt (Detail siehe wiederum  technische Nutzungsmöglichkeiten). Hier muss also kein natürlicher Aquifer vorhanden sein, es eignen sich auch "trockene" Kristallingesteine. Ob und in welcher Form allerdings künstliche Risse zu erzeugen sind, hängt u.a. davon ab, in welchem Spannungszustand sich das Gestein befindet. Mineralabscheidungen können entstandene Risse auch schnell wieder undurchlässig werden lassen. Die Mineralogie der Gesteine ist hier von entscheidender Bedeutung.
technische Nutzungsmöglichkeiten). Hier muss also kein natürlicher Aquifer vorhanden sein, es eignen sich auch "trockene" Kristallingesteine. Ob und in welcher Form allerdings künstliche Risse zu erzeugen sind, hängt u.a. davon ab, in welchem Spannungszustand sich das Gestein befindet. Mineralabscheidungen können entstandene Risse auch schnell wieder undurchlässig werden lassen. Die Mineralogie der Gesteine ist hier von entscheidender Bedeutung.
Quellen:
Schellschmidt R. (2003) Webseiten des GGA-Instituts Hannover
Kayser M. & Kaltschmitt M. (1998): Potentiale hydrothermaler Erdwärme in Deutschland. - In: Ehrlich H., Erbas K. & Huenges, E. (Hrsg.): Angebotspotential der Erdwärme sowie rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der Nutzung hydrothermaler Nutzungsanlagen - GeoForschungsZentrum Potsdam, Scientific Technical Report STR98/09.