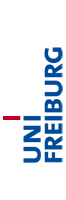Oberrheingraben
Geothermisches Potential im Oberrheingraben
Baden-Württembergs kontinentale Riftzone
Zwischen Schwarzwald und Vogesen, zwischen Odenwald und Pfälzer Wald liegt die nach den Alpen wohl prominenteste geologische Großstruktur Mitteleuropas - der Oberrheingraben. Im Zusammenhang mit der Alpenbildung wurde die Erdkruste hier großmaßstäblich gedehnt, so dass im Zentrum eine tektonische Grabenstruktur von über 200km Länge und 30km Breite entstand. Geographisch deckt sich der Graben mit der dichtbesiedelten Oberrheinebene, die "Grabenschultern" mit den oben genannten Mittelgebirgen.
 | |
| Vereinfachte geologische Schnitte durch den Oberrheingraben zur Zeit seiner Entstehung und heute. Der Graben entstand als tektonischer Ausgleich für eine großangelegte Aufdomung Südwestdeutschlands und seiner Nachbarregionen. (Quelle: FESA) |
Tief versenkte  Aquifere
Aquifere
Der Oberrheingraben wurde zeitgleich mit seiner Einsenkung mit tertiären Sedimenten verfüllt - ohne jegliche Füllung wäre die Senke stellenweise bis zu 5km tief! Die älteren mesozoischen Sedimentgesteine (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, Jura) wurden in Tiefen bis über 3km versenkt - unter anderem auch drei Horizonte, die als potenzielle Thermalwasserhorizonte (  Aquifere) für die Hydrogeothermie interessant sind: Buntsandstein, Oberer Muschelkalk und Hauptrogenstein (Jura).
Aquifere) für die Hydrogeothermie interessant sind: Buntsandstein, Oberer Muschelkalk und Hauptrogenstein (Jura).
 | |
| Geologischer Schnitt durch den Oberrheingraben im Bereich Landau-Karlsruhe. Geothermisch bedeutsam sind in diesem Bereich die Schichten des Buntsandstein und des Muschelkalk. (verändert nach: Doebl & Teichmüller 1979) |
Hohe geothermische Gradienten
Landau in der Südpfalz hat mit ca. 100°/km den höchsten geothermischen Gradienten in Mitteleuropa. Im Oberrheingraben-Durchschnitt beträgt die Temperaturzunahme mit der Tiefe ca. 80°/km. Verglichen mit dem Normalwert für Mitteleuropa von ca. 30°/km sind das enorme Werte! Die hohen Temperaturen stehen unmittelbar mit der Grabenbildung in Zusammenhang: Wo sich die Erdkruste und der oberste Teil des Erdmantels (die "Lithosphäre") dehnen, kommt die darunterliegende heiße "Asthenosphäre" der Erdoberfläche näher. Gerade mal beruhigende 50km festen Gesteins trennen uns im Oberrheingraben vom zähflüssigen Astenosphärenmaterial. Das sorgt für deutlich erhöhte Wärmeflüsse.
 | Temperaturen des oberen Muschelkalks im südlichen Oberrheingraben. Dicke schwarze Linien bezeichnen tektonische Störungen, an denen Gesteinspakete gegeneinander verschoben wurden. (verändert nach: LGBR 2004) |
Lokale Unterschiede
Das uneinheitliche Muster der Muschelkalk-Temperaturen wird durch abrupte Änderungen der Tiefenlage an tektonischen Störungen und Zirkulation der Tiefenwässer innerhalb der Grabenfüllung kontrolliert: an den Grabenrändern sinkt kaltes Wasser ab, im Inneren steigt es erwärmt wieder auf. Der unter dem Muschelkalk gelegene Buntsandstein ist um die 10° wärmer, der ebenfalls interessante Hauptrogenstein aufgrund seiner geringeren Tiefenlage etwa 20° kühler (Bad Bellingen).
Quellen:
Doebl F. & Teichmüller R. (1979) Zur Geologie und Geothermik im mittleren Oberrheingraben. - Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf., 27, 1-17.
fesa - Förderverein Energie- und Solaragentur Regio Freiburg e.V. (2005) Geothermie am Oberrhein. Leitfaden und Marktführer für eine zukunftsfähige Energieform. - Freiburg, 1-72.
LGBR (2004) Webseiten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) Freiburg - Fachbereich Geothermie.