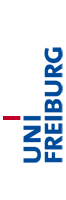Hydrogeothermie
2000-4000m
Wo natürliche tiefe Thermalwasserhorizonte erbohrt werden können, fällt die Wahl unter den technischen Nutzungsverfahren klar zur Gunsten der Hydrogeothermie aus. Wie bei einer Brunnenbohrung kann unter diesen Voraussetzungen heißes Wasser gefördert werden. Wird es an anderer Stelle abgekühlt wieder in den Untergrund injiziert, entsteht eine „Geothermische Doublette“ – das Prinzip der heute erfolgreichsten Geothermischen Kraftwerke.
Einziger Nachteil: das Verfahren ist an besondere geologische Voraussetzungen gebunden, die längst nicht überall erfüllt sind (  Natürliche heiße Grundwasserleiter). Sind diese im Untergrund vorhanden, können aus Tiefen zwischen 2000 und 4000m ohne besondere technische Vorarbeiten bis zu 140°C heiße Wässer gefordert werden. Die Nutzung kann in Form von Nah- oder Fernwärmenetzen erfolgen, wobei der Wärmeinhalt der Tiefenwässer auf einen sekundären Wasserkreislauf übertragen wird. Auch eine Verstromung ist möglich.
Natürliche heiße Grundwasserleiter). Sind diese im Untergrund vorhanden, können aus Tiefen zwischen 2000 und 4000m ohne besondere technische Vorarbeiten bis zu 140°C heiße Wässer gefordert werden. Die Nutzung kann in Form von Nah- oder Fernwärmenetzen erfolgen, wobei der Wärmeinhalt der Tiefenwässer auf einen sekundären Wasserkreislauf übertragen wird. Auch eine Verstromung ist möglich.
 | Eine Auswahl bestehender Hydrogeothermie-Standorte in und um Deutschland. Alle Anlagen liegen in Bereichen, wo Sedimentgesteine durch Beckenbildung in große Tiefen versenkt wurden (gelbe Hintergrundfarbe). |
Mit 8000 Megawatt weltweit erfolgreich
Hydrogeothermische Anlagen sind das „etablierte“ Verfahren der Tiefen Geothermie. Die größten hydrogeothermischen Anlagen liegen freilich in aktiven Vulkangebieten, wo nicht so tief gebohrt werden muss, um an das „heiße Nass“ zu kommen: im Geyser Valley in den USA werden 1500 Megawatt elektrischer Leistung erzeugt, Indonesien deckt über 30% seines Primärenergieverbrauchs aus dieser Quelle, weitere bekannte Anlagen stehen in Italien (Larderello) und Island (Krafla). In Deutschland muss man tiefer bohren. Immerhin sind schon etwa 30 Anlagen in Betrieb, die zusammen ca. 100 Megawatt thermischer Leistung erbringen, weitere 15 Anlagen sind derzeit in Planung. Nur in Neustadt-Glewe wird heute bereits Strom aus hydrogeothermaler Energie gewonnen, Leistung: 230 Kilowatt.
| Prinzip der Geothermischen Doublette. Um den Oberflächenverbrauch gering zu halten, wird mit "abgelenkten" (d.h. nicht vertikalen) Bohrungen gearbeitet. Der "Primärkreislauf" des Thermalwassers ist vom "Sekundärkreislauf" (z.B. Heiznetz) getrennt. |  |