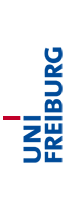Hot Dry Rock - Prinzip
Das Hot Dry Rock-Prinzip (HDR)
5000m
Im Gegensatz zu den hydrogeothermal nutzbaren Horizonten, wasserreichen Sedimentgesteinen, die durch geologische Pozesse in große Tiefen versenkt wurden, ist das noch tiefer liegende Kristallingestein meist recht "trocken". Dafür aber gehörig warm, wie ein Blick auf entsprechende  Temperaturkarten verrät! Dieses gewaltige Energiepotenzial technisch nutzbar zu machen, ohne auf natürliche Tiefenwässer zurückgreifen zu können - diese Vision heißt Hot Dry Rock-Prinzip (engl. "Heißes, trockenes Gestein").
Temperaturkarten verrät! Dieses gewaltige Energiepotenzial technisch nutzbar zu machen, ohne auf natürliche Tiefenwässer zurückgreifen zu können - diese Vision heißt Hot Dry Rock-Prinzip (engl. "Heißes, trockenes Gestein").
Die technische Aufgabe besteht darin, in 5000m Tiefe in einem bis zu 200° heißen Gestein einen "künstlichen Wärmetauscher" zu erzeugen. Wenn dies eines Tages mit wirtschaftlich tragbaren Mitteln gelingt, winkt als Lohn der Mühen eine potentiell unerschöpfliche, nahezu überall einsetzbare Energiequelle. Das HDR-Prinzip hat das bei weitem größte Potential unter allen erneuerbaren Energien und könnte den Schlüssel zur Lösung des menschlichen Energieproblems liefern. Die hohen Temperaturen machen das HDR-Prinzip zum optimalen Stromlieferanten. Ebensogut kann die Wärme direkt als Nah- oder Fernwärme verwendet werden.
 | Schema eines HDR-Kraftwerks: Mit abgelenkten Bohrungen wird kaltes Wasser in den künstlichen Wärmetauscher injiziert und erhitzt wieder gefördert. Da das Gestein sonst weitgehend impermeabel ist, besteht ein nahezu geschlossener Thermalwasserkreislauf. |
Ein künstlicher Wärmetauscher in trockenem Gestein?
Im Prinzip ist alles ganz einfach: In eine tiefe Bohrung wird unter hohem Druck Wasser verpresst. Das Wasser breitet sich in feinsten Rissen aus und sprengt durch den Druck das Gestein, und die Risse verlängern sich zunehmend. Die Vorgang wird als "hydraulic fracturing" oder Stimulation bezeichnet. Allerdings ist die Rissausbreitung von den geologischen Bedingungen im Umfeld der Bohrung abhängig: nicht nur von Mineralogie und Struktur der Gesteine, sondern auch von den äußeren Spannungen, unter den jeweiligen tektonischen Bedingungen. Fundierte geowissenschaftliche Kenntnisse zur Situation im Untergrund sind also notwendig, um zu prognostizieren, ob die Stimulation Erfolg versprechend ist und in welcher Richtungslage Rissausbreitung zu erwarten ist.
Mit seismischen Methoden kann der Erfolg des "hydraulic fracturing" beobachtet, sozusagen "belauscht" werden. Neben dem Volumen des entstandenen Wärmetauschers, der einige Kubikkilometer umfassen sollte, ist die räumliche Ausdehnung und Orientierung des Kluftnetzes von besonderem Interesse.
| Qualitätskontrolle: drei Generationen von künstlich erzeugten Rissen ("Fracs") in unterschiedlicher Tiefenlage (Soultz-sous-Forêts, Quelle: Weidler, 2001). |  |
Das weitere Prozedere: von einer (oder mehreren) anderen Seite an den Wärmetauscher heranbohren, ihn eventuell durch erneute Stimulation erweitern. Sobald ein durchgängiges Kluftnetz zwischen den Bohrungen entstanden ist, kann kaltes Wasser injiziert und andernorts heiß gefördert werden. Das HDR-Kraftwerk läuft.
Weltweit läuft noch kein Kraftwerk
Versuchsanlagen gibt es in Los Alamos (USA), Cornwall (England), Hijori (Japan) und ganz in unserer Nähe: Im Elsaß bei Soultz-sous-Forêts wird mit EU-Mitteln gebohrt und stimuliert. Ein erstes System künstlicher Risse wurde erfolgreich in ca. 3000m Bohrtiefe angelegt: Wassertemperatur 160°C, Durchflussleistung 90 m3/h. Momentan entsteht in einer Tiefe von 5000m ein noch effektiver Wärmetauscher mit einem anvisierten Austauschvolumen von 360 m3/h.
| Unspektakulär: das HDR-Projekt Soultz-sous-Forêts aus der Luft (Quelle: GtV). |  |
Auch in Baden-Württemberg gibt es Pläne für ein HDR-Projekt: Bei Bad Urach könnte aus einen Bohrtiefe von knapp 4500m 170°C heißes Wasser gefördert werden - und eine elektrische Leistung von 300 MW über einen Zeitraum von 30 Jahren erbringen.
 | Hot Dry Rock- und ähnliche Projekte in und um Deutschland. |
Quellen:
Weidler R. (2001) Webseiten des Geothermie-Projekts Soultz-sous-Forêts
Webseiten der Geothermischen Vereinigung e.V. (GtV)